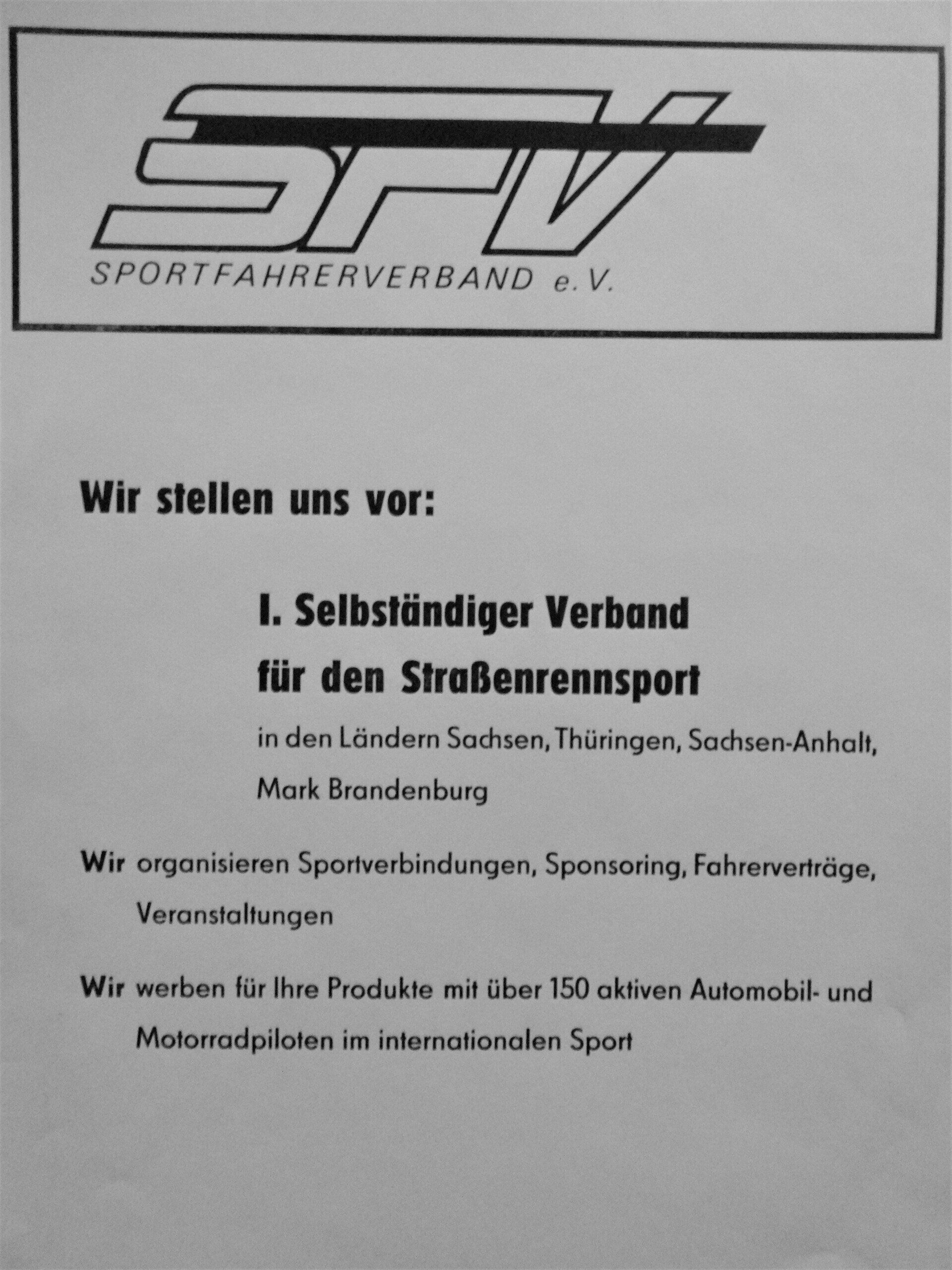Der Verband existiert nicht mehr. Die Verbandsadresse ist nicht mehr relevant.
Der Sportfahrerverband als Alternative zum ADMV
Dieser Verband wurde ursprünglich von den Fahrern aller Klassen 1990 gegründet, da der ADMV weder in der Lage noch Willens war den ehemaligen DDR-Fahrern schnellstmöglich Zugang in den westlichen Sport zu ermöglichen.
Warum wurde der Sportfahrerverband gegründet ?
Die Geschichte beginnt bereits vor dem Fall der Mauer. Im Jahr 1989 waren Fahrer der DDR auf Einladung von Chris Vogler (Heilbronn) zu einem
Rennen nach Hockenheim eingeladen worden. Der ADMV hatte zu diesem Zeitpunkt zwar noch das alleinige Sagen, aber man wollte sich den erkennbaren politischen Entwicklungen nicht komplett entgegenstellen. Schließlich gab es auch in den westdeutschen Verbänden "warme" Posten zu ergattern. Also fand das Ganze statt und hinterher wurden die Teilnehmer attackiert. In dieser Phase wurde aber allen Aktiven klar, das der ADMV sich mit den neuen Bedingungen sehr schwer tun würde. Daraufhin gab es Gespräche mit dem Präsidium des ADMV zur Zukunft des Rennsports, die ausgesprochen fruchtlos und deprimierend verliefen. (Details dazu in meinem Buch)
Als nach längerem Hin und Her klar war, das aus Berlin nichts anderes zu erwarten war als Spott und Häme über unseren "Rennschrott" , entschlossen sich Sportfreunde aus der Rödertal-Rennleitung Eigeninitiative zu entwickeln. Es kam zur Gründung einer regime-unabhängigen Fahrervereinigung, dem Sportfahrerverband e.V. mit dem die Interessen der Fahrer im Einigungsprozess vertreten werden sollten.
Es ging um die Einstufung der Rennklassen, um Renntermine und um internationale Sportlizenzen.
Das es später zum kompletten Bruch mit dem ADMV kam war ausschließlich dem Wirken der alten Funktionäre zu verdanken, die nichts unversucht ließen den SFV zu sabotieren. Dies ist eine lange und unglaubliche Story und wer mehr wissen will kann dies gern erfragen oder wartet auf weitere Informationen.
(Hierzu folgen weitere Informationen)
Presseerzeugnisse und Pressestimmen zur Arbeit des SFV und zu den Rennserien.
Die Gründungsveranstaltung des Sportfahrerverbandes am 4. Februar 1990 im Klubhaus des Arzneimttelwerkes Radebeul, zu der 190 Personen erschienen waren, darunter 80 aktive Fahrer und viele DDR Meister aller Klassen, wurde zur Grundlage einer neuen motorsportlichen Ausrichtung in der Noch-DDR.
Vom ersten Tag an haben sich die Leitungsmitglieder des SFV auf den Weg in den "Westen" gemacht um bei ONS, OMK, Sportfahrerkreis und den Verbänden von ADAC, DMV und AvD über die Bedingungen und Möglichkeiten der DDR-Sportler zu informieren und Startmöglichkeiten zu erwirken. Dort wo man es in alleiniger Konsequenz verfolgt hat, brachte es Früchte. Dort wo man den ADMV eingebunden hatte ging es schief, oder wurde sogar absichtlich sabotiert. Diese Praxis betraf natürlich nicht die einzelnen Vereine des Verbandes, die selbst ums Überleben kämpften, sondern die oberste Leitungsebene.
Als für die ersten Rennteilnahmen im Westen (ohne ADMV-Segen) gedroht wurde den Fahrern Startverbote zu erteilen, war es der SFV der absichern konnte das diesen Personen im Ernstfall entsprechende bundesdeutsche Lizenzen erteilt würden.
In zahllosen Verhandlungen, mit endlosen Fahrtkilometern wurden Renntermine organisiert, eigene Veranstaltungen inszeniert und am Ende komplette Rennserien aus der Taufe gehoben.
- 1990 Racing Pokal für Rennwagen Gruppe E 1300 und Tourenwagen Gruppe A 600
- 1991 Trabant-Racing-Cup und Formel-Euro-Easter- Cup (mit allen späteren Folge-Serien)
Bedauerlicherweise ist im Laufe der Zeit und aus unterschiedlichen Gründen das gesamte Konzept der Ursprungsideen des SFV nicht aufgegangen. So konnten nur die Rennsportklassen erhalten werden in denen die Aktiven tatsächlich auch massiv mitgewirkt haben.
Nach der Wende hatten aber viele Fahrer eigene Pläne, zum Teil mit hochfliegenden Zielen im "Westsport". So spalteten sich die Interessen zwischen Gutbetuchteren, Leistungsstärkeren und Individuelleren von den reinen Hobby-Sportlern ab. Der vor der Wende "erzwungene" Zusammenhalt zerfiel recht schnell und so war es angesichts internationaler Vorgaben schwer, bestimmte DDR-typische Rennsportklassen als Ganzes zu erhalten. Am Zeitigsten lösten sich die Motorradklassen in den internationalen Regelwerken auf. Die OMK/FIM ließ keine "Sonderklassen" zu. Das wäre bestenfalls mit einem kompletten Feld von MZ-Motorrädern gelungen. Das gab es aber nicht.
Bei den Tourenwagen zerfiel die Gruppe A 1300 recht schnell in individuellen Alleingängen und einem international existierenden Wertungsklassensystem, meist Markenpokale und offene Kategorien in denen mit den Lada und Skoda allerdings nicht viel zu gewinnen war.
Das sah zumindest bis 1992 bei den Trabanten A 600 anders aus. Hier half ein geschlossenes Markenfeld, welches sogar von seinem "Exotencharakter" profitieren konnte. Am Anfang gab es auch noch genügend Fahrer die ihre Klasse erhalten wollten. Und dem SFV war es bei den Gesprächen mit der ONS gelungen diesen Marken-Sonderstatus genehmigt zu bekommen. 1990 wurde daraufhin der Trabant-Racing-Pokal vom SFV ausgeschrieben und demnach nicht, wie häufig falsch dargestellt, vom ADMV. (Detaillierte Information sind im Buch "Der Formelsport des Deutschen Ostens" nachzulesen.)
Grundsätzlich galt auch bei den "Trabbis" von Anfang die Forderung der FIA nach reglementskonformen, technischen Anpassungen wie Katalysatoren, Sicherheitstanks und Lautstärkebeschränkungen. Das wurde in den ersten Jahren von den Aktiven auch mitgetragen, denn sie wollten nicht in die Gruppe H abgedrängt werden. Bedauerlicherweise gelang es in den folgenden Jahren nicht die Fahrerfelder zu stabilisieren. Zum einen spielten dabei sicher existenzielle Probleme manches Aktiven eine Rolle. Anderen wurde der Sport mit seinen steigenden Kosten einfach zu teuer und den Dritten waren die Reisewege im Rahmen der SFV-Veranstaltungen (in ganz Europa) zu weit. Das ließ sich aber nicht ändern, weil nur das gemeinsam aufgebrachte Startgeld Rennteilnahmen überhaupt ermöglichte. Das war bei den kleinen Starterfeldern der "Trabbis" aber von Anfang an das Problem und so sprangen die Formelpiloten aus alter Verbundenheit mit ihren Einzahlungen mehrfach dafür ein das es überhaupt zu Trabant-Rennen kommen konnte. Da dies nie publiziert wurde, ist das den meisten ehemaligen Aktiven vermutlich gar nicht bewusst geworden. Nur als die Starterfelder noch kleiner wurden gingen die Formelsportler auf die Barrikaden und der SFV konnte die Zuzahlungen für Ostblockfahrer und Trabantpiloten nicht mehr rechtfertigen. Der SFV hat damals seine Rücklagen, die ihm später von Nutzen gewesen wären aber fehlten, dem gemeinsamen Sportbetrieb geopfert. Und da mir bekannt ist, dass es unter den Trabantsportlern nach Ende der Schirmherrschaft des SFV teils recht unfreundliche Anmerkungen gab, bitte ich diese mit dem Wissen von heute zu überdenken.
Im Jahr 1992 kam es, bei nur noch 8 eingeschriebenen Fahrern im Trabant-Racing-Cup, dazu das die ONS dessen Prädikat entzog und es somit keine offiziellen Startmöglichkeiten dieser Fahrzeuge im Rahmen genehmigter Rennen in ganz Europa mehr gab.
Es war Helmut Assmann, Trabbi-Legende aus Gotha, zu verdanken das er ein neues Veranstaltungskonzept im Historischen Rennsport entwickeln half.
Die erfolgreichste Überlebensgeschichte zeitigte die Gemeinschaft der Formel- Easter- Fahrer. Auch wenn von den Leistungsträgern viele nicht mehr mitziehen wollten oder konnten (Bernd Kasper hatte aufgehört/ Ulli Melkus war tödlich verunglückt) saßen andere gedanklich schon im Porsche-Cup, in der DTM oder der Formel 3. Aus der oberen Leistungsebene kam jedenfalls wenig Zuspruch für ein weiteres Engagement im "alten" Sport. Es blieben aber genügend bodenständige und realistische Fahrer übrig die ihren Sport über die Zeit retten wollten. Mit ihrer Hilfe gelang es dem SFV mit dem Formel-Euro-Easter-Cup (und Folge-Serien) weitere 12 Jahre Formelsport aus DDR-Erbe zu erhalten. Auch wenn dies in vielen Köpfen von Fahrern, Organisatoren und Funktionären belächelt wurde, weil sie den "Ostschrott" schon komplett entsorgt hatten und damals auch keiner an einen historischen Wert des Ganzen geglaubt hat. Das kam erst viel später !
Der Erste der dies erkannte war 1996 Ralf Hecker der als Restaurator im Dresdner Verkehrsmuseum die "Historische-Renngemeinschaft" e.V. gründete, die später Grundlage für die von Stromhardt Kraft formierte HAIGO wurde.
(Das soll es fürs Erste zu diesem Thema gewesen sein)
Mitglieder des erweiterten Rates des Sportfahrerverbandes e.V:
Leitungsmitglieder :
Lutz Blütchen Dresden (Präsident und Promoter FEC)
Joachim Holstein Dresden(Vizepräsident und Leiter Motorradsportkommission)
Rainer Sehm-Schmidt Radebeul (Leiter Automobilsportkommission)
Uwe Stelzer Dresden (Leiter PR und Medien)
Knut Kästner Dresden (Leiter Computer undZeitnahme)
Andreas Bieber Dresden (Leiter Technik)
Annett Thieme Dresden (Leiterin Büro und Organisation)
Birgit Stark Radebeul (Leiterin Finanzen)
Berater und zeitweilig Aktive
Bernd Fulk Bautzen (ständiger Sprecher/PR)
Rainer Fröhlich Dresden (2.Pressesprecher/ PR)
Dr. Manfred Wobst Dresden (Streckensicherheit)
Wolfgang Küther (Technik)
Technischer Kommissar : Wolfram Albrecht Anweiler
Sportkommissar : Eberhard Hänsel Bautzen
zeitweilige Koordinatoren zum ADMV:
Helmut Assmann Gotha (Tourenwagen)
Lothar Reschke Dresden (Formelwagen)
Die Rödertal-Rennen in Liegau-Augustusbad 1985 bis 1989
In Abstimmung mit den Verlegern des Buches "Die Geschichte der Rödertal-Rennen in Liegau-Augustusbad"
folgen hier in den nächsten Wochen detailliertere Informationen zu den Rennveranstaltungen der Jahre 1985 bis 1989.
In diesem Zusammenhang ist interessant das 30 Jahre nach diesen Veranstaltungen außer ein paar wenigen alten Einwohnern in Liegau-Augustusbad niemand mehr von den Ereignissen Kenntnisse hat. Auch scheint es dort, wie übrigens in anderen Orten unserer Recherchen ebenfalls, das alles was aus DDR-Zeiten in der Geschichte eines Ortes einmal eine Rolle gespielt hat, heute nicht mehr existent ist. Das ist deshalb bedauerlich, weil bestehende Geschichtsvereine dann eben wieder einmal nur gefilterte und halbe Wahrheiten vermitteln. Da schimpfen wir über gestürzte Denkmäler gefallener Herrscher in allen Ländern bis hin zu den Ägyptern, welche die Gesichter in den Stelen und Inschriften aushacken ließen, befinden uns aber auf dem gleichen Level der Geschichtsverdrehung wie vor 4000 Jahren.
Wir haben in Erinnerung an eine tolle Gemeinschaftsleistung von Sportlern, Organisatoren und Ortskräften ein paar Fakten zusammengetragen die nach unserer Meinung zur Traditionspflege beitragen können, soweit sie nicht von Ignoranz und Arroganz unterbunden werden.
Warm up
Der Osten Deutschlands hat eine lange Motorsportgeschichte. Angefangen bei den Eisenacher Wartburg Werken, den Wanderer-Werken, Sachsenring/Horch und der späteren Auto-Union haben ostdeutsche Akteure viele Jahre lang den Deutschen Motorsport mitbestimmt. Vor dem letzten Weltkrieg war es maßgeblich bei der Entwicklung der Silberpfeile und nach dem Krieg speziell in Dresden, mit der „Rennwagenschmiede Melkus“, bei der Stabilisierung einer Motorsportszene bis zur Wiedervereinigung.
Wer darüber etwas exakter informiert werden will, sollte sich das Buch „Der Formelrennsport des Deutschen Ostens“ von Lutz Blütchen zu Gemüte führen. (erhältlich über lublue51@web.de oder www.formelsport-ostdeutschlands.de)
Der ehemalige Bezirk Dresden kann in seiner Geschichte auf dem Gebiet des Motorrennsports daher auf eine lange Tradition zurückblicken. Hier fanden neben den Rennen auf der Autobahnspinne Dresden-Hellerau und dem Bautzener-Autobahnring auch in Lückendorf beim Bergrennen regelmäßig Motorsportveranstaltungen statt. Wenn auch nur kurzzeitig, so wurden bereits in den Vorkriegsjahren vereinzelt Rennen auf dem "Deutschland Ring" in Hohnstein im Elbsandsteingebirge gefahren.
Zur geschichtlichen Einordnung der nachfolgenden Seiten gilt es zu erwähnen das nach Kriegsende, in der damaligen russischen Besatzungszone, der späteren DDR, das Streben nach motorsportlicher Betätigung vielseitige Initiativen hervorbrachte. Zwar war bis 1949 eine derartige offizielle Sportbetätigung noch verboten, aber hinter den Kulissen rumorte es bei vielen technisch begeisterten Personen um wieder etwas Unterhaltung in die kriegsgebeutelte deutsche Gesellschaft zu bringen. Da war Fußball noch nicht das Non-plus-Ultra !
Im Westen hatte man bereits entgegen den Vorstellungen der Alliierten inoffizielle Rennen ausgerichtet und auch im Osten gab es intensive Bemühungen den russischen Druck zu unterwandern. In den Folgejahren etablierte sich eine riesige Gemeinde von Motorsportfreunden die den Grundstein für einen, zeitweise sogar von der Regierung der DDR geförderten Automobilrennsport, legte. An Sachsenring, Schleizer-Dreieck, Bernauer-Schleife, Bautzener-Autobahnring und Dresdner-Autobahnspinne, um nur einige Strecken zu nennen, versammelten sich in manchen Jahren bis zu 1 Million Zuschauer. Alleine der Sachsenring zählte zeitweilig 400 000 bei einem Rennen.
Im Verlaufe des kalten Krieges und der wirtschaftlichen Herausforderungen mussten die DDR-Sportbehörden im nichtolympischen Sport Rückzieher machen, zu denen auch der Automobil-und Motorradrennsport zählte, obwohl die Erfolge speziell bei den Motorrädern von MZ bemerkenswert waren. So starben neben vielen ehemaligen Rennstrecken auch zahlreiche technische Projekte, wie die MZ 250 R und der AWE. Allerdings hielten bei den privaten Aktiven verschiedene namhafte Sportler an ihren Ideen fest. Stellvertretend sollen hier nur Heinz Melkus und Willy Lehmann genannt sein.
Nach der 72er SED-Zäsur zugunsten der Olympia-Sportarten bedeutete das Überleben des Automobilrennsports in der DDR einen unermüdlichen Kampf um Ressourcen und Akzeptanz. Und das betraf nicht nur die Techniker sondern auch die Organisatoren der übrig gebliebenen Rennstrecken : Sachsenring, Schleizer Dreieck und Frohburger Dreieck.
Neben diesen Hauptveranstaltungen waren aber auch immer wieder einzelne Motorsportclubs und hartnäckige Einzelakteure bemüht Bergrennen zu veranstalten. Am Lückendorfer Berg, am Heuberg bei Gotha, am Glasbach bei Bad Liebenstein, am Weinberg bei Naumburg, am Kyffhäuser und vielen anderen Orten gab es so einmalige oder kontinuierlich wiederkehrende Rennen gegen die Stoppuhr und im Einzelstart.
Diese Bergrennen waren Bestandteil der DDR-Meisterschaften und Bestenermittlungen, auch wenn sie von den meisten Fahrern nicht bejubelt wurden. Diese Rennen bargen trotz bestmöglicher Bemühungen der Veranstalter immer ein größeres Risiko als die routiniert durchorganisierten Rundstreckenrennen. Alleine die natürlichen Gegebenheiten aus den geografischen Bedingungen und der natürliche Bewuchs ergaben Gefahrenstellen die man nicht einfach weg zaubern konnte. Auch schon vor 5 Jahrzehnten in der DDR konnte man nicht einfach störende Straßenbäume fällen. Das zu verhindern bedurfte es nicht einmal euphorisch grüner Fanatiker. Das wussten damals auch alle normalen Bürger.
Hinzu kam, das bei Unfällen auf Bergrennstrecken die Entfernungen zu medizinischen Einrichtungen in der Regel weit weg waren und dies konnte gegebenenfalls über Leben und Tod entscheiden. Dennoch gab es diese Rennen und in den Regionen wo sie statt fanden erfreuten sie sich wachsender Beliebtheit bei den Zuschauern.
Seit dem Ende der Autobahnspinne bei Dresden-Hellerau war für die Dresdner Motorsportszene Ende mit den Geräuschen von Rennmotoren und dem Geruch von Rennbenzin. Obwohl in Dresden eine Hochburg des Automobilrennsports lag (in den 80er Jahren kamen etwa 20 aktive Rennfahrer aus dieser Gegend), herrschte Motorsportflaute was die Veranstaltungen betraf.
Als späterer Initiator des Rödertal-Rennens lernte ich als Kind noch die „Spinne-Rennen“ schätzen und trauerte deren Einstellung 1972 lange nach. Für uns damalige Jungs, aus unserem Heimatort Klotzsche, waren diese Rennen ein Highlight im Kinder-und Jugenddasein. Für manchen von uns prägten diese Erlebnisse sogar die spätere Berufswahl und das Sport-Engagement.
Als ich 1983 nach endlosen Jahren Zuschauer-Dasein, selbst aktiv in den Formelrennsport einstieg und die Gepflogenheiten des Rennbetriebes kennen gelernt hatte, reifte in mir der Gedanke im Großraum Dresden wieder ein Rennen zu initiieren. Zuerst informierte ich mich natürlich bei den Ausrichtern etablierter Bergrennen an denen ich selbst als Fahrer teil nahm.
Daher hatte ich nach geraumer Zeit einen Überblick über notwendige Anforderungen, über die Anzahl von Helfern, die Unterbringung und Versorgung der Aktiven und vieles andere mehr. Gemeinsam mit Sportfreunden des Motorsportclubs „MTC Touring Dresden“
und den Jungs aus meinem Rennsportteam begannen wir daher verschiedene Möglichkeiten zu prüfen um selbst ein Rennen zu organisieren. Insgesamt hatten wir anhand von Landkarten und Ausflügen in die Dresdner Umgebung 14 potenzielle Orte fixiert an denen es möglich erschien ein Rennen zu organisieren. Natürlich hatten wir als primäres Ziel ein Rundstreckenrennen im Auge.
Also verfassten wir einen Aktionsplan in dem wir alle Erfordernisse und Vorstellungen zu Papier brachten und den man gegebenenfalls auch Interessenten aushändigen konnte. Diesen ersten Plan konnte ich leider nicht mehr auffinden und gegebenenfalls als Beleg hier einfügen.
Jedenfalls zogen wir als erstes zur Autobahnmeisterei nach Dresden-Hellerau. Dort war man schließlich für die ehemalige „Spinne“ zuständig.
Anmerkung : Alle nachfolgenden Ausführungen basieren auf persönlichen Aufzeichnungen und Recherchen in Archiven deren Anfänge etwa 30 Jahre zurückliegen und mehrheitlich aus Orginaldokumenten stammen.
Variante 1 : Die Wiederbelebung der Autobahnspinne
In diesem Zusammenhang kam es zu Gesprächen mit den Verantwortlichen des Straßen- bzw. des Autobahnwesens, die zwar recht begeistert schienen, uns aber schnell klar machten das jeder Kubikmeter Beton, jede Leitplanke und jeder Haufen Kies einer speziellen Genehmigung bedurfte. Dies wiederum setzte das Einverständnis maßgeblicher politischer Kreise voraus. Schnell wurde auch klar, dass das um das Jahr 1985 herrschende Autobahnverkehrsaufkommen eine mehrtägige Sperrung der Autobahn Dresden-Berlin, bzw. Dresden-Bautzen nicht zu rechtfertigen schien und erst recht nicht zu organisieren wäre. Daher schlugen wir eine Teilnutzung der Autobahn vor bei der einspurig in allen Richtungen der Verkehr aufrecht erhalten werden konnte. Da diese Idee nicht gleich verworfen wurde gingen wir sogar soweit einen neuen zusätzlichen Streckenteil an die Autobahn anbinden zu wollen (Zeichnung C). Letztendlich brachten erhebliche Sicherheitsbedenken für den fließenden Verkehr und natürlich immense, ungeplante Kosten für den Straßenbau das Projekt zum Erliegen. Wir sahen das natürlich alles etwas anders, aber es gab keine Lobby mehr für ein Autorennen in der Stadtnähe. Vor allem hätten da dermaßen viele Leute in dermaßen vielen Institutionen ihr OK geben müssen das wir dort das wirkliche Problem erkannten. Da wollte keiner mehr Ärger und Arbeit als es sowieso schon gab.
Variante 2 : Die Nutzung des Autobahnzubringers zwischen Auffahrt Dresden-Nord und dem Hammerweg
Nach der Spinne-Absage erkannten wir in deren unmittelbarer Nähe ein brauchbares Straßenkonstrukt zwischen dem Autobahnzubringer Dresden-Nord und dem stadtwärts einbindenden Hammerweg.
Grundsätzlich wäre eine solche Streckenlösung (siehe Abbildung) renntechnisch perfekt denkbar gewesen. Sowohl die Möglichkeit eines Fahrerlagers war gegeben und günstige Zuschauerbedingungen, inklusive Verkehrsleitung schienen lange Zeit real.
Außerdem war mit dem Friedrichstädter Krankenhaus die medizinische Hilfe im Ernstfall praktisch um die Ecke.
Zeichnungen des Hellergeländes mit Autobahnzubringer und Hammerwegschleife. Bild D
In den Tagen eines Rennens wäre die Sperrung der verlängerten Hansastraße als Autobahnzufahrt Dresden-Nord durch die Zufahrt „Wilder Mann“ eine gute Umgehungsvariante gewesen. Allerdings hätte das eine rechtzeitige Verkehrsumleitung vor allem des Transitverkehrs erfordert, was grundsätzlich über die Großenhainer Straße kein Problem gewesen wäre.
Günstig war vor allem das auf dem Heller-Gelände praktisch kaum Lärmbelästigungen von Anwohnern zu befürchten waren und weder Bäume noch seltene Tiere die „schlechte Rennluft“ hätten einatmen müssen.
Das Streckenprofil entsprach damaligen Rennstrecken im Westen für die Deutsche-Tourenwagenmeisterschaft die mancherorts in Industriegebieten gefahren wurde. Das war aber eines der großen Probleme. Die DDR wollte keine westlichen Gegebenheiten nachmachen. Und schon gar nicht für Motorsport ! Ich denke heute unsere Anfragen an die zuständigen Behörden nahm keiner wirklich ernst. Als wir aber eines Tages mit einem Verantwortlichen ins Gespräch kamen, sah unser Anliegen gar nicht so verheerend aus. Zumindest schien es dafür Luft zu geben. Bei intensiver Betrachtung stellte sich aber heraus das der katastrophale Straßenzustand des Hammerweges ein unlösbares Problem war. Auf dem damaligen (und ich glaube heute noch vorhandenem) Kopfsteinpflaster ging natürlich kein Rennen zu fahren. Die bautechnische Begutachtung ergab schließlich eine Ablehnung, weil der offensichtlich enorme straßenbautechnische Aufwand der Bergpassage des Hammerweges nicht realisierbar war. Über diese Straße lief bei starkem Regen jede Menge Wasser ab, was durch das Pflaster teils aufgesaugt und gebremst wurde. Eine Asphaltierung hätte umfangreiche Melioration bedeutet. Zumindest waren derartige Kosten nur mit aufwendigen Genehmigungsverfahren zu generieren und da waren wir beim selben Problem wie bei der Spinne.
Später stellte sich noch heraus das es vermutlich wegen des sowjetischen Hubschrauberlandeplatzes auch erhebliche Zustimmungsprobleme gegeben hätte.
Also mussten wir auch mit dieser Variante einpacken.
Blieb noch eine 3. Rundstreckenvariante. (Fortsetzung folgt)




Es darf geraten werden was das ist. Aufklärung und weitergehende Informationen in der Broschüre "Die Geschichte der Rödertal-Rennen",
oder hier wenn es eine Einigung mit dem Verlag gibt.